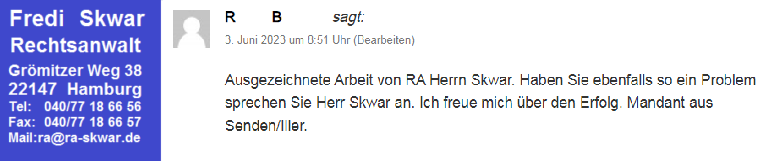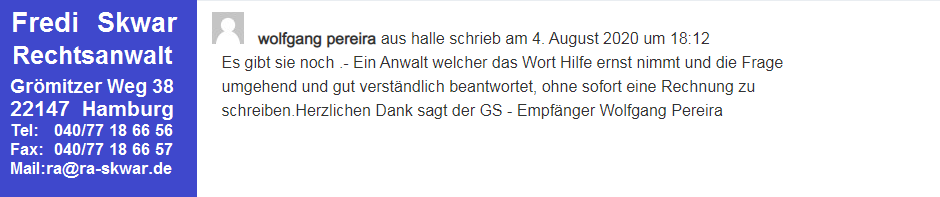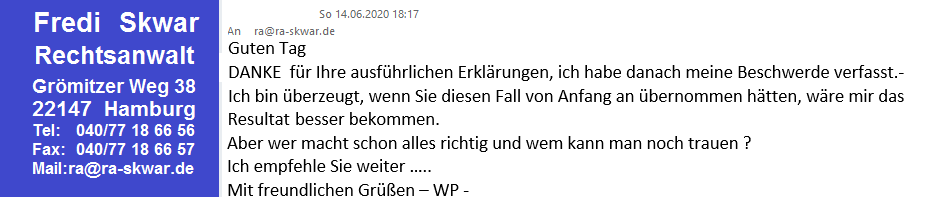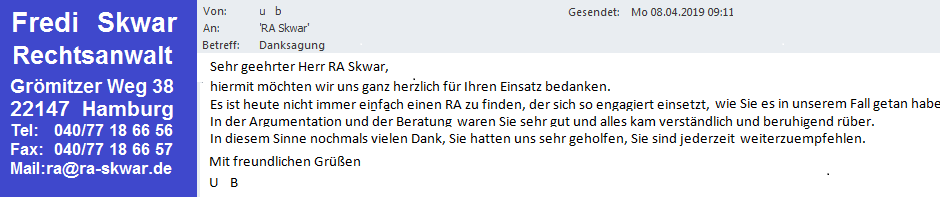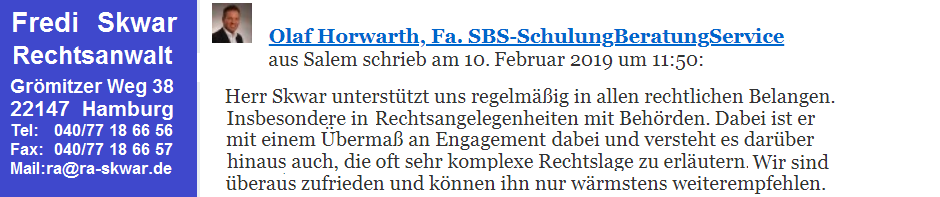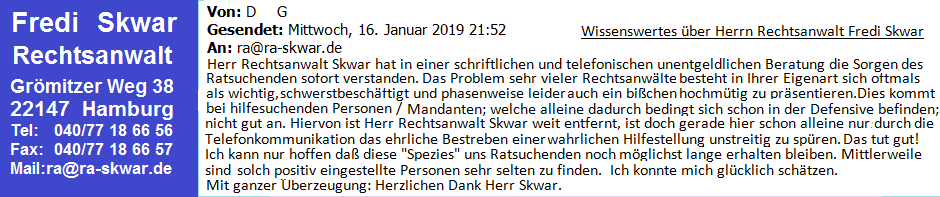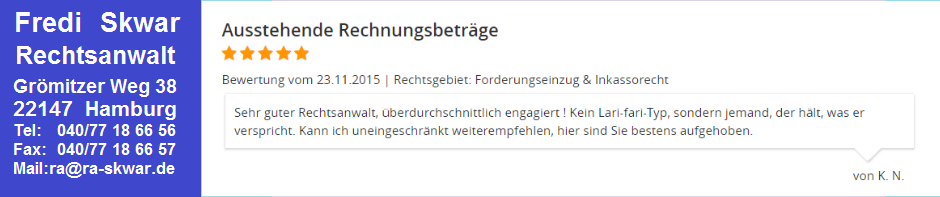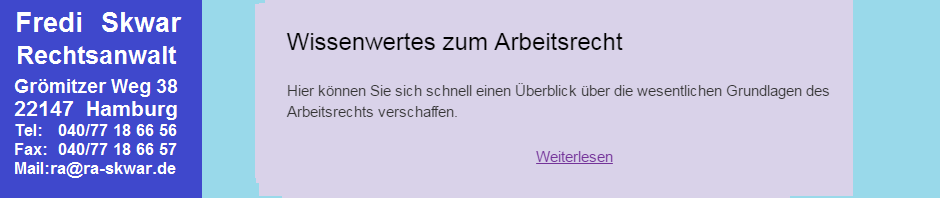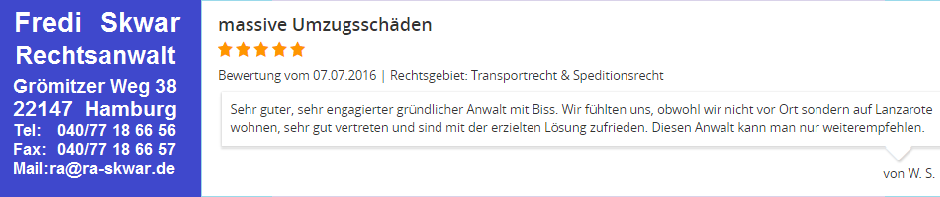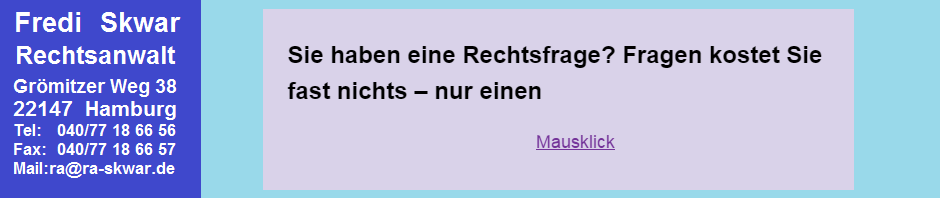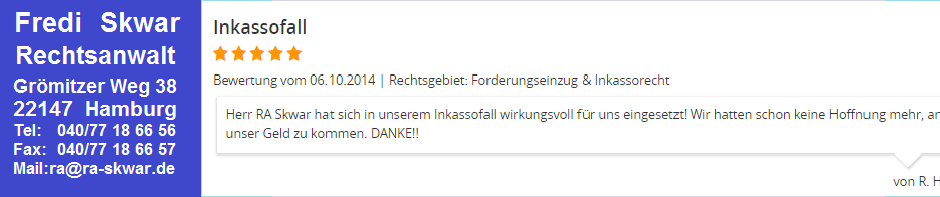Niedersächsisches OVG, Beschluss vom 29. Juli 2016 – 2 ME 135/16
Zur Reichweite des Verschlechterungsverbots bei Neubewertung einer Klausur in der Ersten Juristischen Staatsprüfung
Tenor
Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Göttingen – 4. Kammer – vom 17. Juni 2016 wird zurückgewiesen.
Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwerdeverfahren auf 3.750 EUR festgesetzt.
Gründe
Der Antragsteller begehrt – weiterhin – die bessere Benotung einer Aufsichtsarbeit in der Ersten juristischen Staatsprüfung, die bereits Gegenstand eines Senatsbeschlusses vom 28. Januar 2016 war (- 2 ME 255/15 -, juris).
Die hier noch in Rede stehende Klausur ZR 3 war ursprünglich von beiden Prüferinnen mit „ausreichend“ (4 Punkte) bewertet worden. Auf Widerspruch des Antragstellers hoben sie im Überdenkungsverfahren die Note auf 5 Punkte an. Ein im „Täuschungs- und Widerspruchsverfahren“ ergangener Bescheid des Antragsgegners vom 29. Juni 2015 bewertete diese Klausur sodann jedoch wegen Täuschung durch Benutzung eines nicht zugelassenen Hilfsmittels mit Null Punkten.
Der Senat hat den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, die Aufsichtsarbeit ZR 3 des Antragstellers unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts durch die Prüfer vorläufig fehlerfrei neu bewerten zu lassen.
4Dem lag zugrunde, dass der Antragsteller in Bezug auf den Täuschungsvorwurf geltend gemacht hat, er habe eine Reihe von exemplarischen Klausurlösungen auf Anraten eines Facharztes auswendig gelernt, um psychische Stabilität zu gewinnen. Zufällig habe er bei der hier fraglichen Aufsichtsarbeit auf eine dieser Lösungen zurückgreifen können, sie aus dem Gedächtnis reproduziert und durch Umstellungen an die konkret gestellte Aufgabe angepasst. Der Senat hat vor diesem Hintergrund als zweifelhaft angesehen, dass die Täuschungen betreffende Vorschrift des § 15 NJAG auf diesen Sachverhalt angewendet werden könne, und deshalb eine vorläufige Neubewertung durch die Prüfer mit folgender Maßgabe für erforderlich gehalten:
„Wird die Bewertung der Prüfungsleistung einschließlich ihrer Eigenständigkeit in diesem Sinne als Aufgabe der Prüfer verstanden, führt dies hier zur Notwendigkeit einer vorläufigen Neubewertung unter der Prämisse, dass die gegenwärtige Bewertung mit „ungenügend“ nach § 15 Abs. 1 NJAG nicht haltbar ist. Dabei unterliegt die Neubewertung keinem Verschlechterungsverbot, weil nur so einer Bewertung auch unter dem Gesichtspunkt der „Eigenständigkeit“, d.h. unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem vorliegenden Verfahren für den Fall Raum verschafft werden kann, dass die Prüfer hierin maßgebliche Bewertungsgesichtspunkte erblicken.“
Daraufhin haben beide Prüferinnen die Klausur mit „mangelhaft“ (drei Punkte) bewertet.
Einen erneuten Eilantrag des Antragstellers hat das Verwaltungsgericht mit dem angegriffenen Beschluss vom 17. Juni 2016 abgelehnt, weil die Neubewertungen inhaltlich nicht zu beanstanden seien. Soweit sie erstmals die mangelnde Eigenständigkeit der erbrachten Leistung bemängelten, entspreche die daraus folgende Verschlechterung der Bewertung den Vorgaben des oben genannten Senatsbeschlusses und sei im Einzelnen ebenfalls inhaltlich nicht zu beanstanden. Das Verschlechterungsverbot solle nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur Änderungen des Bewertungssystems unterbinden, die hier nicht vorlägen. Grund für die Neubewertung sei nicht die Beanstandung einer fehlerhaften Bewertung gewesen, sondern die fehlerhafte Annahme eines Täuschungsversuchs, der zur Bewertung mit Null Punkten geführt habe. Nunmehr seien die Prüferinnen zu einer besseren Note als Null Punkte gelangt. Dass diese schlechter als die zuvor vergebene Punktzahl gewesen sei, beruhe auf der zuvor nicht berücksichtigten Erkenntnis, dass Teile der Klausurbearbeitung aus der Wiedergabe einer nahezu wortgleichen, zuvor auswendig gelernten Musterlösung bzw. BGH-Entscheidung bestanden habe.
Entgegen der Auffassung des Antragstellers sei die vorherige Bewertung nicht bereits unter Berücksichtigung dieser weitgehenden Übereinstimmungen erfolgt. Die Erstgutachterin habe dem Antragsgegner zwar den Verdacht einer Täuschung aufgrund der Übereinstimmungen mit der Entscheidung des BGH mitgeteilt, jedoch sei aus einer Verfügung des Antragsgegners vom 21. April 2015 hervorgegangen, dass das Überdenkensverfahren unabhängig von der Prüfung eines Täuschungsversuchs weitergeführt werden solle. Die Erstgutachterin habe deshalb die von ihr festgestellten Anhaltspunkte für einen Täuschungsversuch außer Betracht gelassen. Der Zweitgutachterin sei der Verdacht eines Täuschungsversuchs nicht mitgeteilt worden. Der Senat habe in der oben genannten Entscheidung eine Bewertung auch unter dem Gesichtspunkt der ‚Eigenständigkeit‘ d.h. unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem Eilverfahren für den Fall verlangt, dass die Prüfer hierin maßgebliche Bewertungsgesichtspunkte erblickten.
Die Wiedergabe wortgenau auswendig gelernten Textes im Rahmen einer Klausurbearbeitung weise auf eine geringere Eigenständigkeit im Sinne selbständigen Denkens hin als eine Falllösung, die das Resultat eigener Überlegungen unter Einbringung des zuvor Erlernten darstelle. Eine Änderung des Bewertungsmaßstabs sei damit nicht verbunden. Das Vorhandensein eigenständiger Überlegungen zur Falllösung zeichne das juristische Verständnis eines Kandidaten aus und stelle deshalb ein anerkanntes Bewertungskriterium dar.
Mit seiner dagegen gerichteten Beschwerde rügt der Antragsteller unter anderem, dass der Antragsgegner das prüfungsrechtliche Verschlechterungsverbot außer Acht gelassen habe.
Der Antragsgegner tritt dem entgegen.
Die Beschwerde hat keinen Erfolg. Das Beschwerdevorbringen, auf dessen Überprüfung der Senat gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, rechtfertigt nicht die Änderung des angegriffenen Beschlusses.
Dabei kann offen bleiben, ob ein Anordnungsgrund im Hinblick auf den gegenwärtigen gesundheitlichen Zustand des Antragstellers nicht vorliegt, wie der Antragsgegner meint, denn auch in der Sache greifen die Einwände des Antragstellers gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, deren Begründung der Senat im Wesentlichen folgt, nicht durch. Ergänzend ist nur folgendes auszuführen:
14Soweit der Antragsteller – hauptsächlich – geltend macht, die Neubewertung sei unter Verstoß gegen das prüfungsrechtliche Verschlechterungsverbot erfolgt, existiert ein solches Verbot entgegen seiner Auffassung nicht als ein verselbständigtes Dogma; der Begriff des Verschlechterungsverbots beleuchtet vielmehr nur schlagwortartig bestimmte rechtliche Folgerungen aus dem prüfungsrechtlichen Grundsatz der Chancengleichheit. Es bedarf daher auch keines besonderen Rechtssatzes, um die Gültigkeit dieses „Verbots“ einzugrenzen; die Konturen des prüfungsrechtlichen Grundsatzes der Chancengleichheit ergeben sich vielmehr unmittelbar aus Art. 3 Abs. 1 GG. Wie das Bundesverwaltungsgericht insbesondere in seinem Urteil vom 14. Juli 1999 (- 6 C 20.98 -, BVerwGE 109, 211 = NJW 2000, 1055) hervorgehoben hat, verbietet der Grundsatz der Chancengleichheit eine Verschlechterung des Prüfungsergebnisses bei einer erforderlichen Neubewertung der Prüfungsleistung nur, soweit sie auf einer Änderung des Bewertungssystems oder einem Nachschieben beliebiger Gründe beruht. Das Verbot der Änderung von Bewertungskriterien steht seinerseits unter Vorbehalt, dass das ursprünglich angewandte Bewertungssystem rechtmäßig war (vgl. BVerwG, a.a.O. juris Rdnr. 18 mit Hinweis auf Beschl. v. 11.6.1996 – 6 B 88.95 -, juris). Das Verschlechterungsverbot ist auch nicht berührt, wenn der Prüfer nach der Korrektur eines früheren Bewertungsfehlers die Prüfungsleistung anderweitig anhand der sich dann ergebenden Kriterien misst. Ergeben sich dabei neue Einwendungen, so stellen sie sich lediglich als Folge der Rücknahme der ursprünglichen Kritik dar. Die Berücksichtigung solcher Einwendungen bei der Neubewertung kann auch darum nicht als ein unzulässiges Nachschieben beliebiger Gründe angesehen werden, als von den Prüfern nicht verlangt werden kann, bei jeder Einwendung gegen eine Prüfungsleistung hilfsweise zu erläutern, wie die Prüfungsleistung zu beurteilen wäre, wenn die Einwendung nicht zuträfe (BVerwG, Urt. v. 14.7.1999 – 6 C 20.98 -, juris Rdnr. 25).
Bezugspunkt des Verschlechterungsverbots ist hier nicht die im Bescheid vom 29. Juni 2015 verhängte „Sanktionsnote“ von Null Punkten – die nicht mehr verschlechtert werden könnte -, sondern der letzte Stand der Prüferbewertung im Überdenkungsverfahren. Dies gilt unabhängig davon, dass die Verhängung der Sanktionsnote hier im vorangegangenen Eilverfahren ohnehin durchgreifenden Zweifeln begegnet ist. Eine Verschlechterung kann sich jedenfalls nur auf vorangegangene inhaltliche Bewertungen von Prüfungsleistungen beziehen. Hier verwendet § 15 Abs. 1 Satz 1 NJAG zwar Formulierungen („ist die betroffene Prüfungsleistung in der Regel mit der Note „ungenügend“ zu bewerten“), denen eine gewisse begriffliche Unschärfe innewohnt und den Gedanken nahelegen könnten, auch die Sanktionsnote habe den Charakter einer Bewertung im eigentlichen prüfungsrechtlichen Sinne. Das stünde jedoch im Widerspruch zu der Regelung des § 11 Abs. 1 Satz 3 NJAG, wonach sich das Landesjustizprüfungsamt einer „endgültigen Beurteilung von Prüfungsleistungen“ zu enthalten hat; für schriftliche Prüfungsleistungen obliegt diese nach § 13 Abs. 1 NJAG den dazu bestellten Mitgliedern des Landesjustizprüfungsamtes, also den Prüfern. Wie die aufgeführten Beispiele für Täuschungshandlungen zeigen, hat der Gesetzgeber aber in erster Linie an Verhaltensweisen gedacht, die nicht im Blickfeld jedenfalls der Prüfer von schriftlichen Prüfungsleistungen liegen, sondern etwa von Aufsichtsführern bei Klausuren. Das stützt eine Auslegung, wonach eine Bewertung im eigentlichen prüfungsrechtlichen Sinne nicht gemeint ist, sondern eine vom möglicherweise verbleibenden Wert der Leistung losgelöste echte Sanktion. Dass hierfür nicht die Prüfer berufen sind, sondern unmittelbar das Landesjustizprüfungsamt, wird zudem dadurch nahegelegt, dass für bestimmte Fälle nach § 15 Abs. 1 Satz 3 NJAG auch die weitergehende Sanktion eines Nichtbestehens der gesamten Staatsprüfung zu Gebote steht; dies ginge über die den Prüfern nach § 13 Abs. 1 NJAG zugewiesenen Befugnisse hinaus. Hinzu kommt, dass die Verhängung einer Sanktionsnote – anders als möglicherweise die „normale“ Bewertung einzelner Prüfungsleistungen (vgl. Morgenroth, NVwZ 2014, 32) – in jedem Fall einen Verwaltungsakt darstellt (vgl. auch VG Göttingen, Beschl. v. 29.3.2004 – 4 B 32/04 -, juris), zu dessen verfahrensrechtlicher Entstehung und inhaltlichen Ausgestaltung die Prüfer nur einen begrenzten Beitrag leisten könnten.
Muss die Sanktionsnote mithin außer Betracht bleiben, soweit es für das Verschlechterungsverbot auf eine vorangegangene inhaltliche Bewertung der Prüfungsleistung ankommt, ist maßgeblicher Bezugspunkt hier – mindestens – die erste Beurteilung mit jeweils vier Punkten; zu berücksichtigen ist freilich auch – wenn auch zum Teil nur mit Vorbehalten – die Heraufsetzung im Überdenkungsverfahren um jeweils einen Punkt. Letztere hatte zwar noch nicht förmliche Außenwirkung erlangt, verlangt aber gleichwohl Beachtung, soweit hierin die ursprüngliche Bewertung korrigiert und verdeutlicht worden ist.
Entgegen der Darstellung des Antragstellers unterlagen die Prüferinnen nicht schon deshalb einer „Ermessensbindung“, weil sie spätestens im Überdenkungsverfahren alle relevanten Fakten gekannt hätten. Unabhängig davon, das hier nicht die Ausübung von Ermessen in Rede steht, sondern die Inanspruchnahme eines prüfungsrechtlichen Bewertungsspielraums (vgl. dazu im Einzelnen Senatsurt. v. 2.7.2014 – 2 LB 376/12 -, NVwZ-RR 2015, 299, juris Rdnrn. 39 ff.), war der Erkenntnisstand im Überdenkungsverfahren noch ein anderer. Zwar hat die Erstvotantin zeitgleich mit ihrer Stellungnahme im Überdenkungsverfahren vom 17. April 2015 den Antragsgegner mit gesondertem Anschreiben darauf aufmerksam gemacht, dass die Klausur textliche Übereinstimmungen mit dem BGH-Urteil vom 5. Juni 2009 (- V ZR 144/08 -, BGHZ 181, 233) aufweise, und um Prüfung gebeten, ob eine Aberkennung der Klausurleistung wegen eines Täuschungsversuchs in Betracht komme, weil sich der Schluss aufdränge, dass dem Antragsteller die BGH-Entscheidung während der Klausurerstellung in Textform vorgelegen haben müsse. Veranlasst war dies durch Einwendungen des Antragstellers selbst, der mit Schriftsatz vom 30. März 2015 Wert auf die Feststellung gelegt hatte, dass seine Falllösung derjenigen des Bundesgerichtshofs entsprach. Die Erstvotantin hatte hiernach zwar bereits erhebliche Zweifel an der Eigenständigkeit der Leistung, sah aber die Zuständigkeit für eine Bewertung unter diesem Gesichtspunkt nach § 15 Abs. 1 Satz 1 NJAG beim Antragsgegner. Jedenfalls dann, wenn ein Prüfer im Widerspruchsverfahren in der Auffassung, die eigentliche Bewertung und die Prüfung eines Täuschungsversuches hätten verfahrensrechtlich unterschiedliche Wege zu gehen, zwei sich in der Sache ergänzende Stellungnahmen abgibt, sind diese im weiteren Verfahren richtigerweise als Einheit zu betrachten und ergeben erst zusammen die maßgebliche Bewertung. Mit anderen Worten stand die günstige Bewertung mit 5 Punkten unter dem Vorbehalt der Feststellung eines Täuschungsversuchs und gab damit zur Eigenständigkeit der Prüfungsleistung keine abschließende Bewertung ab. Hinzu kommt, dass die Erstvotantin zunächst nur die Übereinstimmungen mit der BGH-Entscheidung erkannt hatte, nicht aber, dass die Übereinstimmungen mit der Klausurlösung des Repetitoriums, in der die BGH-Entscheidung verarbeitet war, noch deutlich weiter gingen. Der Zweitvotantin sind die Bedenken der Erstvotantin nach einem Vermerk des Antragsgegners vom 21. April 2015 von vornherein nicht mitgeteilt worden, so dass sie bei ihrer Stellungnahme im Überdenkungsverfahren entgegen der durchgängigen Darstellung des Antragstellers in Unkenntnis der nunmehr aufgefallenen Umstände war. Die Annahme einer Ermessensbindung kommt unter diesen Umständen nicht in Betracht.
Anders als bei den für das Verschlechterungsverbot typischen Fallgestaltungen hat der Senat in seinem Beschluss vom 28. Januar 2016 nicht diese Bewertungen der Prüferinnen als fehlerhaft angesehen, sondern (in Voraussicht) nur die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs verhängte Sanktionsnote. Gleichwohl greifen die oben dargestellten prüfungsrechtlichen Grundsätze hier – sinngemäß – ein, weil die vom Senat vorzunehmende Abgrenzung zwischen Täuschung und noch erlaubtem Verhalten jedenfalls zur Folge hatte, dass die Prüferinnen bei der ihnen auferlegten Neubewertung auch neue Erkenntnisse zu berücksichtigen hatten. Der Senat hat ihnen explizit aufgegeben, im Rahmen ihres Bewertungsspielraums – insbesondere bei der Beurteilung der Eigenständigkeit der Prüfungsleistung – nachträglich Umstände einzubeziehen, die (nachdem die Erstvotantin im Überdenkungsverfahren bereits Verdacht geschöpft hatte) in vollem Umfang erst im gerichtlichen Eilverfahren bekannt geworden sind. Das rechtfertigt eine Prüfung am Maßstab des Verschlechterungsverbots.
Vor diesem Hintergrund hält der Senat gegen die Auffassung des Antragstellers zunächst daran fest, dass die Eigenständigkeit einer Prüfungsleistung grundsätzlich Gegenstand der Bewertung durch die Prüfer zu sein hat, auch wenn meist kein Anlass bestehen dürfte, besondere Betrachtungen zu „Plagiaten“ anzustellen. Insbesondere wird die Befugnis der Prüfer, Fragen der Eigenständigkeit in die Bewertung einfließen zu lassen, nicht durch den Umstand eingeschränkt, dass für bestimmte Fallgruppen mangelnder Eigenständigkeit, in denen zugleich eine Täuschung vorliegt, besondere gesetzliche Sanktionsmöglichkeiten bestehen. Diese zielen auf den Unrechtsgehalt von Täuschungen ab, nicht auf allgemeine Mängel der Eigenständigkeit, und schränken damit eine Bewertung letzterer nicht ein.
Der Senat hat in seinem Ausgangsbeschluss vom 28. Januar 2016 nicht als selbstverständlich angesehen, dass nachträglich bekannt gewordene Umstände bei einer nicht wegen eigener Fehler der Prüfer erfolgenden Neubewertung zugrunde gelegt werden können, hält dies aber weiterhin für richtig. Zwar kann insoweit keine unmittelbare Parallele zur rechtlichen Behandlung von echten Täuschungshandlungen gezogen werden, deren prüfungsrechtliche Berücksichtigungsfähigkeit vielfach – auch in zeitlicher Hinsicht – durch besondere Bestimmungen festgelegt ist (vgl. hier z.B. § 15 Abs. 2 NJAG) und bei welchen Rechtsprechung und Literatur als selbstverständlich davon ausgehen, dass auch den Prüfern zunächst verborgen bleibende Umstände – wie die vorherige illegale Beschaffung einer „amtlichen“ Klausurlösung – im Nachhinein Berücksichtigung zu finden haben. Gleichwohl gibt es keinen insoweit kontrastierenden Grundsatz dahin, dass Prüfer in Bezug auf die Eigenständigkeit der Prüfungsleistung – deren Beurteilung nach den Darlegungen im Beschluss vom 28. Januar 2016 zuvörderst ihnen auferlegt ist – ihre Überzeugung nur aus dem Inbegriff der anonymisierten Lösung der Klausuraufgabe schöpfen dürfen und im Überdenkungs- und gerichtlichen Verfahren gewonnene neue Erkenntnisse bei einer Neubewertung auszublenden haben. Letzteres ist insbesondere nicht dem Grundsatz der Chancengleichheit geschuldet, sondern es würde das diesem zukommende Gewicht tatsächlich schmälern. Insbesondere stellt sich die zusätzliche Berücksichtigung solcher Umstände nicht als Änderung des Bewertungssystems dar, wenn dieses Fragen der Eigenständigkeit der Prüfungsleistung von vornherein umfasst hat, sondern dieses Bewertungssystem wird dann nur auf einer breiteren Tatsachengrundlage angewandt. Selbst wenn allerdings das ursprüngliche Bewertungssystem der Prüferinnen auf den Gesichtspunkt der Eigenständigkeit der Prüfungsleistung kein besonderes Augenmerk gerichtet hat, wäre dies unschädlich. Denn Prüfer können für den Normalfall davon ausgehen, dass den zu Prüfenden die Falllösung nicht vollumfänglich bekannt ist; sie müssen nicht ohne Not Erwägungen zu völlig atypischen und daher in der Praxis nicht in signifikanter Häufung vorkommenden Ausnahmefällen anstellen. Soweit sich ein solcher „Ausreißer“ gleichwohl einmal ergibt, reicht es deshalb aus, anlassbezogen das bislang ausformulierte Bewertungssystem punktuell auszuweiten, wenn nur damit der Chancengleichheit zugunsten der anderen Prüflinge der ihr gebührende Raum gegeben werden kann.
Letzteres ist hier nach Auffassung des Senats zu bejahen. Zwar entzieht sich die Frage, wann der Grundsatz der Chancengleichheit die nachträgliche Berücksichtigung besonderer Vorkenntnisse verlangt, einer abstrakten Beantwortung über den Befund hinaus, dass dies nur für Extremfälle gelten kann. Jedenfalls für den vorliegenden Fall haben die Prüferinnen aber in nicht zu beanstandender Weise dargelegt, dass die besonderen Vorkenntnisse des Antragstellers eine maßvolle Absenkung der ursprünglichen Bewertung erfordern. Das Ergebnis der Neubewertung erscheint auch unter dem Gesichtspunkt angemessen, dass der Antragsteller eine Verzerrung der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit selbst dadurch hätte vermeiden können, dass er von vornherein in seiner Klausurlösung auf sein Vermögen hingewiesen hätte, eine vorhandene Falllösung auswendig wiederzugeben. Dies hätte die Prüferinnen gleich im ersten Bewertungsdurchgang in die Lage versetzt, seine Fähigkeit zur eigenständigen Falllösung unter Einschluss der Fragestellung zu bewerten, ob er die auswendig gelernte Lösung einfach nur abruft oder sie nur zum Ausgangspunkt für eigenständige Erwägungen nimmt, und insoweit ihr Bewertungssystem von Beginn auf auch auf „Ausreißerfälle“ auszulegen. Nichts anderes hat offenbar auch der Antragsgegner mit seiner Forderung nach „Quellzitaten“ gemeint. Dass die gesamte Klausur mit einer Reihe von Fundstellen für Literatur und Rechtsprechung im Allgemeinen versehen wird, stand dagegen nie in Rede. Jedenfalls nach Auswendiglernen einer gesamten Falllösung dürfte ein gezielter Hinweis auf eine höchstrichterliche Leitentscheidung, welcher die Klausuraufgabe nachgebildet ist, auch unschwer möglich und zumutbar sein.
Ein Bewertungsfehler liegt insbesondere nicht darin, dass die Prüferinnen – wie der Antragsteller meint – folgende Passage aus dem Senatsbeschluss vom 28. Januar 2016 übersehen hätten:
„Denn auszugehen ist zunächst davon, dass der erfolgreiche Rückgriff auf Gelerntes in Prüfungen zu erwarten und positiv zu benoten ist. Wie auch aus der wiedergegebenen Vorschrift des § 2 NJAG hervorgeht, zielt das juristische Studium darauf ab, dass der Prüfling ein Grundgerüst an Kenntnissen erwirbt, das ihn zur „Fallbearbeitung“ nicht nur im Examen, sondern auch im Beruf befähigt. Nützlich hierfür sind nicht nur präsentes Wissen über gängige juristische Begriffsdefinitionen, sondern auch über exemplarische Fallgestaltungen insgesamt und deren angemessene Bewältigung.“
Diese Passage stand im Zusammenhang mit der Frage, wie eine Täuschung von der bloßen ungekennzeichneten Wiedergabe nur längerer Textpassagen abzugrenzen sei. Sie kann nicht dahin verstanden werden, dass schlechterdings jede wörtliche Wiedergabe gelernten Wissens zu einer hohen Benotung führen muss. Das gilt z.B. dann nicht, wenn die reproduzierten Textstellen nicht in eine der Klausuraufgabenstellung gemäße Form weiterverarbeitet werden. Funktion und Stil einer Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofs unterscheiden sich wesentlich von einem in der Ersten Juristischen Staatsprüfung zu erstellenden Gutachten; gerade in der „Umarbeitung“ vom Urteils- in den Gutachtenstil läge erst eine wirklich zu honorierende Leistung. Darüber hinaus müssen sich die übernommenen Textpassagen in einen folgerichtigen gedanklichen Ablauf einfügen, damit sie positiv bewertet werden können. Schließlich ersetzen sie nicht ohne Weiteres eine vom Prüfling erwartete Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Rechtsauffassungen und eine eigene Positionierung des Prüflings, wenn hierauf nach der erkennbaren Anlage der Aufgabenstellung Wert gelegt wird.
Vor diesem Hintergrund vermag die Beschwerdebegründung die Tragfähigkeit der Neubeurteilungen nicht nachhaltig in Zweifel zu ziehen. Die Erstvotantin hat an mehreren Stellen konkret mangelnde „Transferleistungen“ bzw. die fehlende Entwicklung eigener Argumentationsstränge gerügt. Auch die Zweitvotantin hat die übernommenen Textstellen als nicht richtig in der Klausurlösung „verortet“ angesehen und den Übergang in einen Urteilsstil kritisiert. Die entsprechenden Ausführungen sind zwar nicht lang, aber auch nicht substanzlos und stellen sich keineswegs nur als – wie der Antragsteller meint – „einige Worte zur mangelnden Eigenleistung“ dar. Das Verwaltungsgericht hat sich hiermit ausführlich auseinandergesetzt. Dem tritt die Beschwerdebegründung nicht substantiiert entgegen. Eine Befassung mit den Gründen der erstinstanzlichen Entscheidung wird auch nicht durch den oben abgehandelten Hinweis auf die eingerückte Passage des Beschlusses vom 28. Januar 2016 ersetzt.
26Soweit der Antragsteller ferner darauf hinweist, nach einem Beschluss des OVG Saarlouis vom 22. November 2000 (- 3 V 26/00, 3 W 6/00 -, NVwZ 2001, 942) dürfe nicht negativ bewertet werden, wenn sich ein Prüfling weitgehend wortgleich einer BGH-Entscheidung anschließe, welcher die Aufgabenstellung nachempfunden sei, findet sich an der angegebenen Stelle (Rdnrn. 25 ff.) keine Aussage zur „Wortgleichheit“, sondern nur die Darstellung des dortigen Klägers, er habe alle wesentlichen Fragen behandelt, wie sie auch vom BGH behandelt worden seien.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 154 Abs. 2 VwGO, 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 1 GKG.
Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 152 Abs. 1 VwGO, 68 Abs. 1 Satz 5, 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).